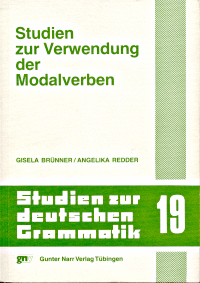
Brünner, Gisela / Redder, Angelika (1983): Studien zur Verwendung der Modalverben
Mit einem Beitrag von Dieter Wunderlich. Tübingen: Gunter Narr Verlag
(Studien zur deutschen Grammatik; Band 19).
zur Hauptseite · zur Publikationsliste
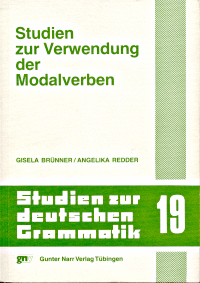 |
Brünner, Gisela / Redder, Angelika (1983): Studien zur Verwendung der ModalverbenMit einem Beitrag von Dieter Wunderlich. Tübingen: Gunter Narr Verlag (Studien zur deutschen Grammatik; Band 19). |
| G. Brünner / A. Redder: Einleitung | 9 | ||
I. |
G. Brünner / A. Redder: Modalverben im Diskurs | 13 | |
| 1 | Die Behandlung der Modalverben in der linguistischen Literatur |
13 | |
| 1.1 | Modalverben in historisch-grammatischen Arbeiten |
14 | |
| 1.2 | Zur Syntax der Modalverben |
16 | |
| 1.3 | Zur Semantik der Modalverben |
18 | |
| 1.4 | Ansätze zu einer pragmatischen Beschreibung der Modalverben |
27 | |
| 2 | Bedeutung der Modalverben |
39 | |
| 2.1 | Handlungstheoretische Bedeutungsbestimmung der Modalverben (A. Redder) |
40 | |
| 2.2 | Modalverben in "inferentieller" Verwendung |
46 | |
| 3 | Modalverben und Verwendungszusammenhänge |
51 | |
| 3.1 | Modalverben und sprachlicher Kontext |
52 | |
| 3.2 | Modalverben und Situation |
61 | |
| 3.2.1 | Begriffliche Bestimmung |
61 | |
| 3.2.2 | Modalverben und Situation: Beispiele |
64 | |
| 3.3 | Modalverben verstehen |
74 | |
| 4 | Ausgewählte Probleme der Modalverb-Verwendung (abstracts) |
79 | |
| 4.1 | Exemplarische Analyse: Arbeitsplanung in einem Büro für Unternehmensberatung |
79 | |
| 4.2 | Exemplarische Analyse: Unterrichtsbeginn in einem Volkshochschulkurs |
80 | |
| 4.3 | Tests zu Bedeutung und Gebrauch von Modalverben |
81 | |
| 4.4 | Modalverb-Verwendung |
83 | |
II. |
G. Brünner / A. Redder: Exemplarische Analyse: Beratung zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen |
91 | |
III. |
A. Redder: Zu ‚wollen’ und ‚sollen’ |
107 | |
| 1 | Stellenwert der Untersuchung |
108 | |
| 2 | Einige grammatische Eigenschaften von ‚wollen’ und ‚sollen’ |
109 | |
| 2.1 | Eigenarten des Formenbestandes |
110 | |
| 2.2 | Einfache Äußerungsformen mit ‚wollen’ und ‚sollen’ |
112 | |
| 2.2.1 | Die Variante (aO) zum Ausdruck einer Handlungsperspektive |
114 | |
| 2.2.2 | Die ‚wollen’-Varianten (bg) und (bO) in ihrer besonderen Leistung |
115 | |
| 2.2.3 | Vergleich von ‚wollen’ und ‚sollen’ |
118 | |
| 2.2.4 | Die Variante (bg) zum Ausdruck einer Ergebnisperspektive |
118 | |
| 2.2.5 | ‚wollen’ in seiner vollen Ausdrucksqualität: die Variante (b1) |
119 | |
| 2.2.6 | ‚haben wollen’ und die Variante (bg) |
122 | |
| 2.2.7 | Perfekt-Partizip und ‚wollen’ in der (bg)- und (a)-Konstruktion: Ausgrenzung der "abgeleiteten" Modalverbverwendung in der Variante (a1) |
123 | |
| 2.2.8 | Die Leistungen von (a0) und (a1) |
127 | |
| 2.2.9 | Die Variante (a2) zum Ausdruck einer prospektiven ex-post Orientierung |
128 | |
| 2.2.10 | Ausdrucksmöglichkeiten einer retrospektiven ex-post Orientierung |
129 | |
| 2.2.11 | Selektionsbeschränkungen der Variante (a4) |
131 | |
| 2.2.12 | Überblick über die Leistungen der diskutierten Formulierungsvarianten für ‚wollen’ und ‚sollen’ |
133 | |
| 3 | Die Bedeutung von ‚wollen’ und ‚sollen’ |
135 | |
Exkurs: ‚sollen’ und Imperativ |
137 | ||
| 4 | Einzelanalysen |
142 | |
| 4.1 | Die Wendung ‚ich wollt(e)’ |
142 | |
| 4.1.1 | ‚ich wollte’ |
143 | |
| 4.1.2 | ‚ich wollt'’ |
147 | |
| 4.1.3 | ‚ich wollte’ versus ‚ich wollt'’ |
151 | |
Exkurs: ‚würd'’ und ‚würde’ |
154 | ||
| 4.1.4 | ‚wollt(e) ich’ |
156 | |
| 4.2 | Zur kommunikativen Leistung von ‚soll ich?’ |
160 | |
IV. |
G. Brünner: Modalverben in schlusstragenden Konstruktionen |
165 | |
| 1 | Art und Anlage der Untersuchung |
166 | |
| 2 | Vorkommenshäufigkeit der Konstruktionen |
167 | |
| 2.1 | Konditionale Konstruktionen |
167 | |
| 2.2 | ‚sonst’-Konstruktionen |
168 | |
| 2.3 | ‚dann’-Konstruktionen |
168 | |
| 2.4 | Finale und konsekutive Konstruktionen |
169 | |
| 2.5 | Kausale Konstruktionen |
170 | |
| 3 | Modalverben in konditionalen Konstruktionen |
171 | |
| 3.1 | ‚wollen’ — ‚müssen’ |
171 | |
| 3.2 | ‚wollen’ — ‚können’ |
177 | |
| 3.3 | Andere Kombinationen |
180 | |
| 3.4 | Kommunikative Funktion der Konditionale |
181 | |
| 4 | Modalverben in ‚sonst’-Konstruktionen |
186 | |
| 4.1 | ‚sonst’-Konstruktionen und ihre Behandlung |
187 | |
| 4.2 | Deontische Notwendigkeitskontexte |
188 | |
| 4.3 | Konditionale Kontexte |
191 | |
| 4.4 | Verhältnis von konditionalen und ‚sonst’-Konstruktionen |
195 | |
| 5 | Modalverben in ‚dann’-Konstruktionen |
197 | |
| 5.1 | ‚dann’-Konstruktionen und ihre Bedeutung |
197 | |
| 5.2 | ‚können’ — ‚müssen’ |
198 | |
| 5.3 | Andere Kombinationen |
202 | |
| 5.4 | Inferentiell gebrauchte Modalverben |
205 | |
| 6 | Modalverben in finalen und konsekutiven Konstruktionen |
207 | |
| 6.1 | Finale Konstruktionen |
208 | |
| 6.2 | Konsekutive Konstruktionen |
210 | |
| 7 | Modalverben in kausalen Konstruktionen |
212 | |
| 7.1 | Ziel-Vorraussetzungsstrukturen |
212 | |
| 7.2 | Inferentiell gebrauchte Modalverben |
216 | |
| 8 | Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse |
217 | |
| 8.1 | Rekapitulation des Vorgehens bei der Analyse |
217 | |
| 8.2 | Rekonstruktion der zugrunde liegenden Schlußprozesse |
218 | |
| 8.3 | Die Rolle der Modalverben in den Konstruktionen |
221 | |
V. |
D. Wunderlich: Modalisierte Sprechakte |
226 | |
| 1 | Einige Vorüberlegungen |
226 | |
| 2 | Können die Modalverben zur illokutiven Kraft eines Sprechaktes beitragen? |
229 | |
| 3 | Drei Beobachtungen über modifizierte Sprechakte |
232 | |
| 4 | Taxonomie und erste Hypothesen |
234 | |
| 5 | Lassen sich die Beobachtungen über modalisierte Sprechakte erklären? |
244 | |
| VI. |
Das Korpus |
246 | |
| 1 | Untersuchte Diskurse |
246 | |
| 2 | Die Auswertung des Korpus |
249 | |
Verzeichnis der Arbeitspapiere |
267 | ||
Literaturverzeichnis |
268 | ||